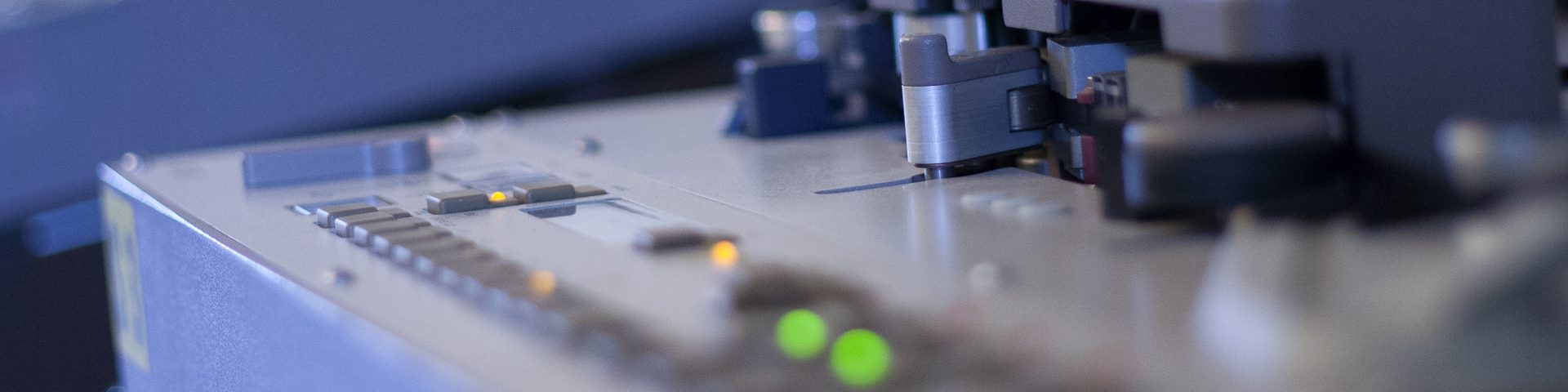(for English version click here)
( -> zurück zu “Projektziel”…)
Durch den auf den ersten Blick “exotischen” Charakter dieses Projekts bringe ich mich und mein künstlerisches Handeln in die Nähe eines für die westliche Welt recht vielschichtigen und gerade aktuell stark aufgeladenen Themenkomplexes – dem des Umgangs mit „anderen Kulturen“.
Nach Jahrhunderten der Vereinnahmung und des „Sich-Bedienens“ an den materiellen und geistigen Vorräten anderer Kulturen, muss die Frage gestellt werden, wieso ein künstlerisches Projekt unbedingt von soviel „Fremdkultur“ durchdrungen sein muss. Könnte man nicht einfach “bei sich” bleiben und sich der Herausforderung stellen “das Eigene” weiterzuentwickeln?
Die Frage ist nachvollziebar und berechtigt, meine Antwort an dieser Stelle aber genauso klar:
Nein. Das kann man nicht.
Denn das mit dieser Forderung einhergehende Problem ist dies: Worin genau besteht denn – „das Eigene“? Wo fängt es an und wo hört es auf? – Und wobei genau soll ich bleiben, wenn es um die Forderung des „bei sich“ geht? [1]
Ist Bach „meins“, die Beatles aber nicht mehr, weil sie aus England kommen? Darf ich die Musik der Bretagne noch analysieren, aber von arabischer Musik sollte ich die Finger lassen, weil ich schon weiß, dass sie „zu fremd“ ist, bevor ich mit der Beschäftigung überhaupt angefangen habe?
In einer gobalisierten Welt, in der Menschen aus verschiedenen Erdteilen sich auf die unterschiedlichsten Weisen kennenlernen – zum Teil über die verschiedenen Möglichkeiten, die das Internet bietet, zum Teil aber auch dadurch, dass sie buchstäblich aus ihren Ländern herausgebombt werden und so die gewaltigen Migrationsbewegungen in Gang kommen, von denen wir zur Zeit Zeuge sind, ist dieses Denken nicht mehr angebracht.
Indem ich auf der Existenz eines „Eigenen“ beharre, erzeuge ich erst das Fremde und grenze es aus. Indem ich das tue, bestätige ich aber gerade dadurch, dass ich mich nur noch „um mich selbst“ kümmere, eben jenen eurozentristischen und kolonialen Diskurs, den ich eigentlich verlassen wollte. Denn erneut bin wieder ich es, die die Grenze zieht. Was ich zuvor ungefragt für mich vereinnahmt habe, grenze ich nun ungefragt aus. Beidem liegt ein asymmetrisches Machtverhältnis zu Grunde. Bei beidem bestimme ich das Verhältnis und begebe mich damit in die dominante Rolle. Bei beidem bleibe ich die „Kolonialherrin“.
Die Menschen, von denen ich meine, dass ich Gefahr laufen könnte ihre Kultur zu “vereinnahmen”, stehen oft direkt vor mir. Sie sind meine Mitbürgerinner und Mitbürger. Worum es in so einer Situation nicht mehr gehen kann, ist, herauszufinden, auf welcher Seite der vermeintlichen Grenze zwischen uns welche kulturelle Praxis anzusiedeln ist und wem von uns sie “gehört”. Vielmehr muss es darum gehen eine Ebene der Kommunikation und des Austausches zu finden, bei der ein gleichberechtigtes Miteinander entsteht und man sich gegenseitig ernst nimmt [2]. D.h. natürlich nehme ich ernst, wenn jemand einen Teil seines kulturellen Wissens für sich behalten möchte, aber ich nehme auch ernst, dass er oder sie dieses Wissen unter Umständen gerne mit mir teilen oder zumindest darüber in einen Austausch kommen würde.
Trotzdem ist es auf der anderen Seite natürlich ebenfalls richtig, sich darüber bewusst zu sein, dass zum einen das menschliche Gehör kulturell konditioniert ist und sich zum anderen das Verständnis für bestimmte Musiken nur durch Kenntnis des kulturellen Kontextes ergibt. Und es ist auch möglich, dass es kulturelle Codes und Prägungen gibt, die mir trotz ehrlichen Bemühens bis an mein Lebensende unverständlich bleiben werden.
Somit ist sie also perfekt, die postkoloniale Lähmung, in der wir uns oft auch dann befinden, wenn wir mit Menschen einer Kultur umgehen, zu der wir in keinerlei postkolonialem Diskurs stehen: Wir müssen feststellen, dass wir bei genauerer Betrachtung „das Eigene“ gar nicht richtig definieren können, wir wissen aber bereits aus Erfahrung, dass uns für „das Andere“ in vielen Fällen das Verständnis fehlen könnte.
Und nun?
Wenn Kulturen zu Menschen werden
Nun nehmen wir Kontakt auf. Nicht mit einer Kultur, nicht mit einem musikalischen System, sondern mit konkreten Menschen.
Den ersten Vertreter des Yungdrung Bön habe ich in Berlin getroffen. Er hieß Tenzin Wangyal und war amerikanischer Staatsbürger. Wangyals Eltern sind aus Tibet nach Indien geflohen, er selbst ist in Indien geboren, wo er in dem gerade errichteten Menri-Kloster die Ausbildung eines tibetischen Bön-Mönchs bis zum Geshe-Grad durchlief. Das entspricht in den USA einem Doktor der Philosophie. Tenzin Wangyal Rinpoche gab nach seiner Ausbildung die Mönchsgelübde wieder zurück und reiste in den Westen. Nun ist er mit Tsering Wangmo verheiratet und die beiden haben zwei Kinder, von denen der ältere sehr gerne Fußball spielt. Die Familie wohnt in Californien. Tenzin Wangyal hat einen Facebook Account und postet Fotos von den verschiedenen Orten, die er bereist. Manche davon sehen so aus, wie man sich die Heimat eines Bön-Vertreters vorstellt. Andere wiederum sind offenbar mexikanische Restaurants irgendwo in den USA. Tenzin Wangyal Rinpoche ist einer der hochgeachtetsten Meditationslehrer des Yungdrung Bön. Leider kennt Tenzin Wangyal sich, wie er selbst sagt, nicht besonders gut mit Ritualmusik aus. – Darauf muss man sich nämlich, wie ich später erfuhr, im Laufe der Mönchs-Ausbildung spezialisieren, und das hat er damals wohl nicht.
Wenn die exotische, ferne Kultur, deren Gesamthintergrund ich laut Theorie vielleicht tatsächlich nie vollständig verstehen werde, auf einmal in Form eines sehr konkreten Menschen vor einem steht, dann ist es plötzlich ziemlich egal, wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt die Annahme ist, dass es in dieser Begegnung zu einem Missverständnis kommen wird. Dieser konkrete Mensch spricht nämlich womöglich gerade zu mir, und während er das tut und ich ihm in seinem So-Sein zuhöre, findet der Austausch bereits statt. Die Begegnung hat längst begonnen.
Die Theorie kann mir unschätzbare Dienste dabei erweisen, diese Begegnung vorzubereiten oder im Nachhinein Unverständliches neu zu beleuchten und verstehbarer zu machen. Ihr kommt ein hoher Wert dabei zu, die Denkmustern zu erkennen, in die wir bei der Begegnung mit dem Anderen oft verstrickt sind. Aber sie kann trotzdem die Begegnung nicht ersetzen.
Die Auseinandersetzung vieler Bön-Vertreter mit dem Westen, die Übersetzung der Bön-Literatur ins Englische und von dort aus in weitere Sprachen, die bewusste Konfrontation der Bönpos [3] mit den Verhaltens- und Denkweisen von Menschen aus westlichen Kulturen kann sicher auf verschiedene Weise gedeutet und begründet werden. In jedem Fall erscheint es mir aber als ein Gesprächsangebot.
Dieses Gesprächsangebot der verschiedenen Bönpos, die mir allein in Deutschland begegnet sind, möchte ich mit der Durchführung dieses Projektes gerne annehmen und den Dialog weiter führen.
Mit dem Aufbau eines Dialoges wiederum ist etwas verbunden, was sich in der Theorie nicht lösen lässt, und das ist die Angst vor Fehlern und die Angst vor Zurückweisung.
Es ist möglich, dass ich im Verlauf dieses Projektes Fehler mache. Vielleicht werden es grobe Verständnisfehler sein, vielleicht sind es aber auch Fehler im sozialen Umgang oder Fehler bezüglich bestimmter Etikette der Bön-Gesellschaft, deren Regeln ich nicht wirklich kenne.
Wenn das passiert, kann ich diese Fehler nicht, wie es bei einem Aufsatz oder Buch der Fall wäre, revidieren und eine neue Auflage unserer Begegnung herausbringen. Ich bin dann darauf angewiesen, dass der andere mir meine Unzulänglichkeit nachsieht. Im Umgang mit anderen Kulturen bin ich dem Wohlwollen meines Gegenübers oft „ausgeliefert“. Und das Wissen darum kann Angst erzeugen.
Ich glaube, dass einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem gleichberechtigten Miteinander darin besteht, sich dieser Angst zu stellen.
Wenn wir uns aus dem befreien wollen, was ich oben die “postkoloniale Lähmung” genannt habe, wenn wir einen ernst gemeinten Dialog wollen, müssen uns der Herausforderung stellen mit unseren Fehlern umzugehen, anstatt um jeden Preis zu versuchen, sie zu vermeiden.
Da ich den Austausch und den Dialog mit den Vertretern des Yungdrung Bön für lohnenswert halte, möchte ich diese Herausforderung gerne annehmen.
—–
[1] vgl. für eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Eigenen und Fremden z.B. Ackermann, Andreas (2011): “Das Eigene und das Fremde: Hybridität, Vielfalt und Kulturtransfers.” in: Jaeger, F. und Liebsch, B. (Hrsg.): “Handbuch der Kulturwissenschaften.” Springer-Verlag GmbH. 2011
[2] vgl. Enrique Dussel: “Karl Otto Apels Bemühen, die universellen Gültigkeitsbedingungen für einen »argumentativen Diskurs« zu definieren, macht deutlich, dass es für jeden Teilnehmer in dem Prozess symmetrische Möglichkeiten geben muss; ansonsten werden die Ergebnisse der Diskussion nicht gültig sein, weil Teilnehmer nicht unter gleichen Bedingungen teilgenommen haben.” Dussel, Enrique: “Eine neue Epoche in der Geschichte der Philosophie: Der Weltdialog zwischen philosophischen Traditionen.” In: polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren. Nr. 24. “Übersetzen”. 2010. Seite 59.
[3] Bönpo = männlicher Vertreter des Bön. (Bönmo = weibliche Vertreterin des Bön)