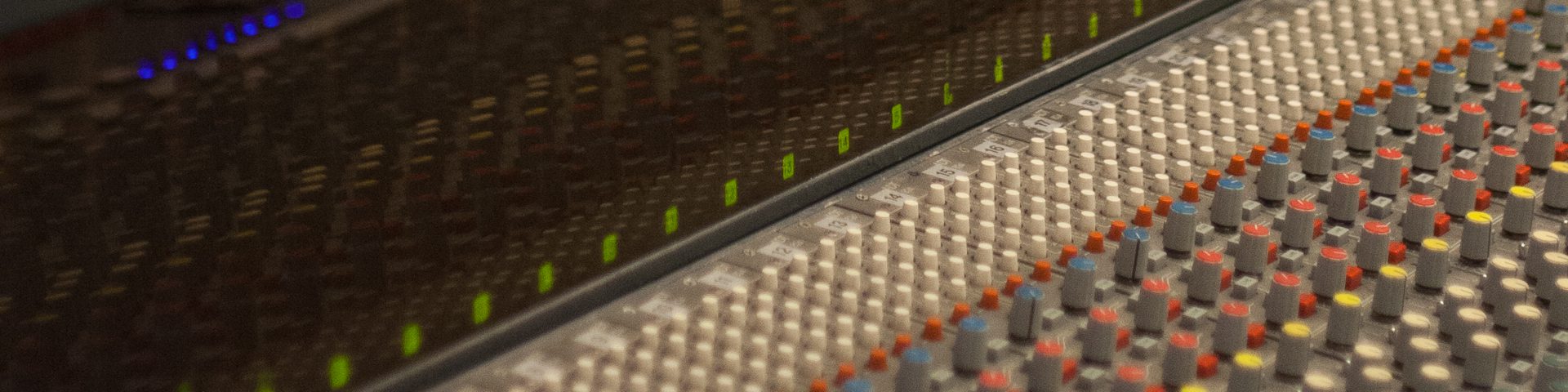-> zur Inhaltsübersicht…
<- zum vorigen Artikel… -> zum nächsten Artikel…
An den beiden Tagen, die der Verbrennung folgten, d.h. am 02. und am 03. Oktober 2017, verbrachte ich einen Großteil der Zeit in der Nähe des Ofens. Ich glaube, etwas in mir war noch damit beschäftigt verstehen zu wollen, was genau eigentlich während des Verbrennungsrituals geschehen war und versuchte dies dadurch herauszufinden, dass es den Ofenplatz fortan nur, wenn unbedingt nötig, verließ, und ansonsten das Geschehen dort genau und aus nächster Nähe beobachtete.
Dies tat ich gemeinsam mit meiner Kamera, die ich als Zeugin und externalisiertes Gedächtnis einsetzte, um sicherzustellen, dass später in Deutschland nichts und niemand, vor allem nicht ich selbst, behaupten könnte, ich hätte mir den Ofen, die Flammen und die Mönche mit den roten Stirnbinden und langen Bambusstangen, die das Feuer bewachten, nur ausgedacht.
Dabei war es gar nicht so sehr der Eindruck, etwas Irrealem oder „nur Geträumtem“ gegenüberzustehen, denn dafür war der Bereich um den Ofen von viel zu viel Normalität umgeben: Die westlichen BesucherInnen unterhielten sich in internationaler Manier ungezwungen auf Englisch mit anderen BesucherInnen, DorfbewohnerInnen oder Mönchen und Nonnen. Einige indische TouristInnen hatten sich ausgerechnet in diesen Tagen zum Sightseeing ins Menri-Kloster verlaufen und wollten nun wissen, welche religiöse Funktion das Feuer dieses offensichtlich fest neben dem Tempel installierten Ofens in der Tradition des Bön einnehme. BesucherInnen, Nonnen und Mönche drehten wie auch in den Tagen zuvor ihre Runden um den Tempel. Einige schweigend, andere Mantren murmelnd und diese still an ihren Malas (buddhistische Gebetskette) abzählend, wieder andere waren in mehr oder weniger ruhige Unterhaltungen vertieft, einige wenige sangen.
Und trotzdem war mir, als hätte sich durch all diese klösterliche Normalität hindurch direkt um den Ofen ein Szenario manifestiert, dass direkt meinem eigenen Inneren entsprungen war. Als wären Archetypen aus meinem Geist aufgestiegen, die seit Jahrtausenden einen festen Platz in meinem Unterbewusstsein gehabt hatten, und als wären diese Archetypen, die seit ungeahnten Zeiten denselben Ofen und dasselbe Feuer in den Tiefen meiner Seele gehütet hatten, nun aus mir „ausgestiegen“, um direkt vor meinen Augen materielle Form anzunehmen und ein eigenständiges Leben zu führen.
Es war, als würde ich auf mich selbst blicken, während ich das Geschehen um den Ofen beobachtete. Die etwas gedämpfte, hämmernde Musik der Rituale, die durch die dunkelroten Wände des Haupttempels zu uns drang, schien diesen Eindruck noch bekräftigen zu wollen und lieferte eine Art Soundtrack zu dem nicht unkomplizierten Szenario, das meine Psyche mir da gerade vorschlug.
Feuerprasseln
Das erste Brennmaterial, mit dem das Feuer angefacht wurde, bestand aus Holz und etwas wie Reisig. Mittelgroße zersägte Stämme wurden bereits einige Tage vor dem Ritual herbeigeschafft, junge Mönche sammelten auf der Wiese hinter der Ofen-Empore Spanholz auf, das im Gras herumlag, entweder, weil es dort immer zu finden ist oder, was wahrscheinlicher ist, weil es mit der Ladung Anmachholz gekommen war.

Nach dem Verbrennungsritual wurde das Feuer zwei weitere volle Tage und Nächte in Gang gehalten, doch wurde es nach Ende der Zeremonie nicht mehr mit einfachem Brennholz gespeist. Stattdessen bekam es ausschließlich die extra dafür hergestellten heiligen Gegenstände und Opfergaben als Nahrung, mit denen der Haupttempel über und über angefüllt worden war. Ein oder zwei junge Mönche, wechselten sich damit ab, die heiligen Brennmaterialien Teil für Teil aus dem Tempel zu holen und dem gerade diensthabenden Hüter des Feuers zu übergeben, damit dieser es den Flammen zuführte.

Da ich in der Nacht vor der Verbrennung nicht zu der letzten Verabschiedung gegangen war, hatte ich unwissentlich auf das Abschiedsgeschenk verzichtet, das dort jeder Gast erhalten hatte: Man hatte, so wurde mir erzählt, Rinpoches Kleidung in lauter winzig kleine Teile geschnitten, und jedem Besucher eines davon in einer kleinen Tüte mit Salz übergeben. 3500 solcher Tüten sollen es gewesen sein, hörte ich.
„Und sie zerteilten seine Kleider“ hallte am Morgen, als ich davon hörte, sofort das in diesem Zusammenhang doch eigentlich wirklich völlig unpassende Bibelzitat in mir wider, „und warfen das Los darüber.“ – unpassend zumindest in der einzigen, ziemlich römer-unfreundlichen Interpretation, die ich kannte und die dafür sorgte, dass ich geradezu erleichtert war, nicht mit einem religionsgeschichtlich derart aufgeladenen Abschiedsgeschenk belastet worden zu sein.
Oder gingen die Römer damals etwa einfach nur einem alten Brauch nach? Vielleicht taten sie gar nichts Despektierliches, wie man es mir hatte weismachen wollen, sondern erwiesen dem gerade von ihnen Gekreuzigten mit dem Teilen seiner Kleidung im Gegenteil eine Art letzte Ehre? Es ist zwar merkwürdig, erst an jemandem die Todesstrafe zu vollstrecken und im Anschluss daran ein Ehrenritual durchzuführen, aber wann waren die Menschen nicht widersprüchlich?
War das Zerteilen der Kleidung also vielleicht einfach ein Brauch, der an beiden Enden der Seidenstraße bekannt war?
Wie dem auch sei, ich spürte, dass dies momentan nicht mein Brauch war und freute mich still, als ich immer mehr den Eindruck gewann, dass Rinpoche dies in Bezug auf mich unter Umständen auch so gesehen haben könnte und ein anderes Geschenk für mich bereit zu halten schien.
Ein Geschenk, das ich mir vor etwas mehr als einem Jahr dringend gewünscht hatte, wenn auch natürlich nicht speziell von ihm. Damals wohnte ich noch in Schreyahn und stellte das Ausgangs-Klangmaterial für meine Komposition „Die Fünf Elemente“ her, – für jedes Element eigene, speziell produzierte bzw. gesammelte Klänge, unterteilt in zwei Arten: Ich wollte jeweils direkt und indirekt mit dem entsprechenden Element in Verbindung stehende Klänge in der Komposition verwenden. Für das Wasser z.B. waren die direkten Klänge Aufnahmen von konkretem Wasser, das aus Schalen ausgegossen wird. Indirekte Klänge waren geblasene Orgelpfeifen eines bestimmten Tonhöhenraums, den ich als für das Element Wasser passend empfand.
Ich stellte in Schreyahn das gesamte Ausgangsmaterial für alle fünf Elemente fertig. Nur für das Feuer wollte sich damals kein direkter Klang finden. Denn dieser hätte ja kaum in etwas anderem bestehen können als in dem Prasseln von Feuer. Aber wie stellt man Feuerprasseln an einem Ort her, an dem man wahrhaftig nicht unbedingt ein Lagerfeuer entzünden möchte, unter Bäumen und zwischen jahrhundertealten Fachwerkhäusern? Außerdem wollte ich ja auch noch, dass es nicht einfach beliebige direkte Klänge waren, sondern dass alle Aufnahmen bzw. das Prozedere der Klangherstellung in irgendeiner Weise mit Bön in Verbindung stehen sollten.
Wie aber ein großes prasselndes Feuer ausfindig machen, dessen Herstellung mit Bön in Verbindung steht? Dafür reichte meine Fantasie damals nicht aus.
Und da mir nichts weiter einfiel, was ich hätte tun können, beschloss ich, dass, sollte in die Komposition tatsächlich Feuerprasseln hineingehören, dieses mir schon irgendwann einmal irgendwo begegnen würde.
Natürlich hätte ich mir damals nicht ausgemalt, dass ich das entsprechende Material ein Jahr später direkt im Herzen des Bön Mutterklosters Menri finden würde.
Eine zeitlang horchte ich aufmerksam in mich hinein, ob die Situation hier an der südwestlichen Ecke des Haupttempels, am Verbrennungsofen des 33. Menri-Trizin, wirklich so lag, dass ich nun mein Aufnahmegerät herausziehen, das Stereomikrofon auf das Feuer ausrichten und tatsächlich den Aufnahmeknopf drücken sollte. War ich hier nicht vielleicht im Begriffe eine gewaltige Pietätlosigkeit zu begehen?
Aber wie aufmerksam auch immer ich in mich hineinlauschte, die einzige Antwort auf mein Zögern war stets das Bild eines verschmitzt lächelnden Menri-Trizins, das aus dem Inneren in mir aufstieg und dem der Gedanke offenbar in keinster Weise missfiel, noch in dem Moment, in dem sein Körper vom Feuer zu Asche und Rauch verwandelt wurde, jemandem eine Freude zu machen, und sei es auch mit so etwas Merkwürdigem wie digitalen Audioaufnahmen vom Prasseln eben diesen Feuers.
„But who will ever listen to that?“ war die einzige Frage, mit der sich das innerlich vorgestellte Bön-Oberhaupt in mir an mich wandte, kopfschüttelnd, aber doch liebevoll den naturentfremdeten Verhaltensweisen der Westler zugewandt, die er offenbar in ihren Wohnungen sitzen sah, wie sie eine CD einschoben, um sich Feuerprasseln (oder Meeresrauschen, oder „Klänge des Urwalds“…) anzuhören, – statt selbst in die Natur zu gehen und sich mit ihr zu verbinden.
Ich erklärte ihm, dass die Herstellung einer solchen CD nicht der Plan sei, sondern dass ich das Material, wenn ich es überhaupt nutzen würde, weiterverarbeiten wolle.
Daraufhin lächelte er nur. Ein Lächeln, das in keiner Weise auf meine Antwort Bezug zu nehmen schien, in das hinein sich jedoch einige Momente später das imaginierte Bild von ihm auflöste. Und kurz darauf zerstäubte auch das Lächeln selbst in den merkwürdig weit gewordenen Raum meines eigenen Inneren.
Und so gewann ich nach einigem Lauschen und Abwarten die Überzeugung, dass Rinpoche mit nicht unbeträchtlichem Vergnügen mitbeobachtet hätte, wie ich schließlich den Aufnahmeknopf meines Zoom Q8 herunterdrückte und gemeinsam mit den unter ihrem Windschutz verborgenen Mikrofonen für relativ lange Zeit dem Klang des Feuers lauschte, das wir nun beide abspeicherten, der Q8 in größter Präzision mit 48.000 Amplitudenmessungen pro Sekunde auf seiner SD-Karte, ich irgendwo in den unerforschten Tiefen meines Erinnerungsraumes.

Ob ich die Aufnahmen am Ende tatsächlich kompositorisch weiterverarbeiten werde, wird die Zeit zeigen.
___________
[1] torma (tib. གཏོར་མ, Wylie: gtor ma): In bestimmter Art geformte Opfergaben aus essbarem Teig.